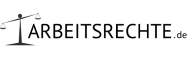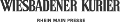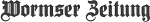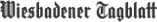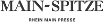Arbeitsgericht Berlin
Urteil vom - Az: 17 Ca 1102/11
Kündigung eines HIV-infizierten Arbeitnehmers in der Probezeit
Wird ein HIV-infizierter Arbeitnehmer wegen der Krankheit gekündigt, so stellt dies keine Diskriminierung wegen einer Behinderung dar. Demnach kann der Arbeitnehmer keine Entschädigung gem. §15 AGG verlangen.
(2.) Die Kündigung eines HIV-infizierten Arbeitnehmers, der im Reinbereich der Medikamentenherrstellung tätig ist und sich in der Probezeit befindet, ist nicht sittenwidrig oder willkürlich, wenn der Arbeitgeber (hier: Medikamentenherrsteller) in einem internen Regelwerk die Beschäftigung HIV-infizierter Arbeitnehmer im Reinbereich ausgeschlossen hat.
Tenor
I. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger ein qualifiziertes Endzeugnis unter dem Beendigungsdatum 24.01.2011 zu erteilen.
II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 4/5 und die Beklagte 1/5 zu tragen.
IV. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf EUR 11.220,-- festgesetzt.
Tatbestand
Der am .......1987 geborene Kläger war bei der Beklagten, einem Arzneimittelhersteller, ab dem 06.12.2010 auf der Grundlage des bis zum 05.12.2011 befristeten Anstellungsvertrages vom 01.12.2010 als chemisch-technischer Assistent gegen eine monatliche Vergütung von 2.200,00 EUR brutto beschäftigt. In Ziff. 2 des Anstellungsvertrages war eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart (vgl. im Einzelnen den Anstellungsvertrag Bl. 11 - 14 d. A.). Hinsichtlich der Tätigkeiten des Klägers im Einzelnen wird auf die ebenfalls am 01.12.2010 von den Parteien unterzeichnete Stellenbeschreibung Bezug genommen (vgl. Kopie Bl. 44 d. A.).
Nach der Arbeitsaufnahme wurde der Kläger, wie andere Mitarbeiter auch, die im Labor/Reinraumbereich tätig sind, mit seinem Einverständnis vom Betriebsrat Dr. C. der Beklagten am 08.12.2010 untersucht. Der Kläger ist HIV-infiziert und teilte dies dem Betriebsarzt bei der Untersuchung am 08.12.2010 mit. In seiner daraufhin am 14.12.2010 gefertigten schriftlichen Beurteilung äußerte der Betriebsarzt, dass er „Bedenken“ gegen eine Arbeit des Klägers im GMP-/Reinraumbereich „entsprechend der Beauftragung vom 01.04.2010“ habe. Als Bemerkung zu evtl. Bedenken fügte Dr. C. an, dass die „Möglichkeit der gemeinsamen Beratung zur Einsatzmöglichkeit des Mitarbeiters, unter Einbeziehung des Mitarbeiters, des Betriebsarztes und der/des Verantwortlichen des Einsatzbereiches“ bestehe (vgl. im Einzelnen die Beurteilung Bl. 16 d. A.). Hinsichtlich des Inhalts der am 01.04.2010 seitens der Beklagten erfolgten „Beauftragung zur Durchführung von GMP-Untersuchungen“ (GMP = Good Manufacturing Practice, deutsch: Gute Herstellungspraxis) an Dr. C. als Betriebsarzt wird auf Bl. 46, 47 d. A. Bezug genommen. In diesem Schreiben teilt die Beklagte Dr. C. mit, dass bei einer „GMP-Untersuchung“ u. a. Untersuchungen auf HIV durchzuführen sind und dass Ausschlusskriterien für Tätigkeiten im GMP-Bereich chronische Hauterkrankungen im Bereich der Arme, Unterarme, Hände und Gesicht, chronisch verlaufende Hepatitis B oder C und HIV sind.
Am 04.01.2011 fand ein Gespräch statt, an dem neben dem Kläger der Betriebsarzt Dr. C., der Geschäftsführer Dr. H. sowie die Personalleiterin Frau F. teilnahmen. Grund des Gesprächs war das Ergebnis der betriebsärztlichen Untersuchung vom 08.12.2010. Dr. C. berichtete nach der Erläuterung der Bedeutung der ärztlichen Schweigepflicht von der HIV-Infektion des Klägers. Dr. C. begründete seine in dem medizinischen Beurteilungsbogen vermerkten Bedenken mit dieser Infektion. Zwischen den Parteien ist streitig, ob Dr. C. - wie vom Kläger behauptet - weiter ausgeführt hat, dass er selber keine Bedenken an der Weiterbeschäftigung habe, da aufgrund der Übertragungswege des Virus eine Übertragung dessen nahezu ausgeschlossen sei.
An diesem Tag kündigte die Beklagte mit einem als „Kündigung während der Probezeit“ überschriebenen Schreiben mit Datum vom 04.01.2011 das Arbeitsverhältnis fristgemäß zum 24.01.2011.
Mit der vorliegenden, bei Gericht am 21.01.2011 eingegangenen Klage wendet sich der Kläger gegen diese Kündigung, begehrt die Feststellung des Fortbestehens des Arbeitsverhältnisses zu unveränderten Arbeitsbedingungen, die Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Höhe von drei Monatsgehältern, und hat zunächst die Erteilung eines qualifizierten Zwischenzeugnisses, hilfsweise für den Fall der Abweisung der Feststellungsanträge, die Erteilung eines qualifizierten Endzeugnisses verlangt.
Der Kläger ist der Ansicht, die Beklagte als Arbeitgeber habe ihn als symptomlosen HIV-infizierten Arbeitnehmer auch während der Probezeit nicht aufgrund der Infektion wirksam kündigen können. Das Verhalten der Beklagten verstoße gegen die guten Sitten, da eine Kündigung aufgrund einer Krankheit, die nicht die Tätigkeit des Angestellten beeinflussen könne, dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widerspreche. Auch aufgrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sei der Diskriminierung von Bewerbern beim Zugang zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position einschließlich des beruflichen Aufstiegs verboten. Das Verhalten der Beklagten verstoße daher gegen ein gesetzliches Verbot. Im Übrigen könne in der Arzneimittelherstellung eine HIV-Infektion kein Ausschlusskriterium für Tätigkeiten im GMP-Bereich sein. Ausschlusskriterium mag eine ansteckende Krankheit sein, da damit die Verunreinigung der Präparate vermieden werde. Nach dem Infektionsschutzgesetz sei das HI-Virus zwar ein Krankheitserreger, hieraus könne nicht zwangsläufig auf eine ansteckende Krankheit geschlossen werden. Der HI-Virus gehöre zu den schwer übertragbaren Krankheitserregern; außerhalb des menschlichen Körpers sei er nicht überlebensfähig, so dass selbst bei einer Verletzung eines HIV-Infizierten keine Infektionsgefahr für Dritte stehe. Die Kündigung des Klägers aufgrund seiner HIV-Infektion nicht einmal einen Monat nach dessen Arbeitsbeginn sei entsprechend der Ablehnung eines Bewerbers aufgrund seiner Behinderung zu werten. Die HIV-Infektion stelle aufgrund ihres Hindernisses für die Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben eine Behinderung i. S. d. AGG dar. Der Kläger habe entsprechend § 15 AGG einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe von drei Monatsgehältern.
Der Kläger beantragt,
1. festzustellen dass das Arbeitsverhältnis zwischen dem Kläger und der Beklagten durch die Kündigung vom 04. Januar 2011 nicht aufgelöst worden ist;
2. festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungstatbestände endet, sondern zu unveränderten Bedingungen fortbesteht;
3. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger eine angemessene Entschädigung in Höhe von drei Monatsgehältern zu zahlen;
4. die Beklage zu verurteilen, dem Kläger ein qualifiziertes Endzeugnis unter dem Beendigungsdatum 24.01.2011 zu erteilen.
Die Beklagte erkennt den Zeugnisanspruch an und beantragt im Übrigen,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte bestreitet, dass Herr Dr. C. in dem Gespräch am 04.01.2011 gesagt habe, dass er selber keine Bedenken gegen eine Weiterbeschäftigung des Klägers habe. Dr. C. habe dem Kläger vielmehr in dem Gespräch erläutert, dass die Formulierung „Bedenken“ in der Beurteilung so zu verstehen sei, dass eine Tätigkeit im „GMP/Reinraumbereich“ ausgeschlossen sei. Nachdem Dr. C. die HIV-Infektion mitgeteilt habe, habe der Geschäftsführer Dr. H. darauf erklärt, dass eine HIV-Infektion zur Kündigung zwinge. Dem habe Dr. C. nicht widersprochen. Die Kündigung sei auch nicht etwa bereits vor dem Gespräch erstellt worden. Vielmehr habe Frau G. das Gespräch zwischendurch verlassen, um die Kündigung auszufertigen. Frau G. habe der den Schriftsatz unterzeichnenden Rechtsanwältin auch von der Situation berichtet und erklärt, dass sie nun die Kündigung ausfertigen werde.
Die Vorgaben an den Betriebsarzt mit dem Schreiben vom 01.04.2010 seien in Zusammenarbeit mit diesem selbst unter anderem auf der Grundlage einer Besichtigung der Arbeitsbereiche der Beklagten erarbeitet worden. Bei der Beauftragung des Betriebsarztes mit Schreiben vom 01.04.2010 mit den GMP-Untersuchungen stütze sich die Beklagte auf ihr internes Regelwerk zur Gesundheitsüberwachung wegen Mitarbeiterschutz und Produktschutz genannt „SOP“ = Standard Operating Procedure“ (Standard-Arbeitsanweisung, vgl. die Anlage B 4 Bl. 48 bis 62 d. A.). Die SOP verweise auf Seite 5 unter Ziff. 5 auf den EG GMP-Leitfaden und stelle klar, dass er als Bestandteil der SOP gelte. Dieser GMP-Leitfaden sei der „Leitfaden der guten Herstellungspraxis“, die Anlage 2 zur Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit zu § 2 Nr. 3 der Arzneimittel- und Werkstoffherstellungsverordnung v. 27.10.2006. Im Kapitel 2 „Personal“ des GMP-Leitfadens heiße es unter Kapitel „Personalhygiene“ zu Ziff. 2.15, dass Vorkehrungen getroffen werden sollten, die, soweit praktisch möglich, sicherstellen, dass in der Arzneimittelherstellung niemand beschäftigt werde, der an einer ansteckenden Krankheit leide oder offene Verletzungen an unbedeckten Körperteilen aufweise. Das Infektionsschutzgesetz, dessen §§ 6, 7 und 34 ebenfalls Bestandteil der SOP seien (Anlage 6), definiere in § 7 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz „HIV und AIDS“ als Krankheitserreger. Auf das Stadium der Infektion bzw. Krankheit komme es damit nicht an. Die Arzneimittel- und Werkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) stelle die Umsetzung der Richtlinie 2003/94/EG ins deutsche Recht dar. Der gesamte GMP-Leitfaden, der daher auch EG GMP-Leitfaden genannt werde, sei geltender Bestandteil der internen Regeln der Beklagten. Dabei sei die Umsetzung des GMP-Leitfadens durch den pharmazeutischen Unternehmer durch die Festlegung eigener Kriterien in diesem Bereich die einzig mögliche Vorgehensweise. Eine solche Festlegung durch die zuständige Behörde selbst sei nicht zu erreichen. Der pharmazeutische Unternehmer trage auch die alleinige Verantwortung für sein Handeln. Die zuständige Behörde überwache dies nach § 64 AMG.
Die Beklagte sehe zu ihrer Entscheidung keine Alternative. Die Verunreinigung der von ihr hergestellten Arzneimittel mit Krankheitserregern könne sie nicht verantworten. Die Beklagte produziere radioaktive Medikamente für Krebspatienten, die nach der Herstellung nur 10 Stunden wirksam seien. Der Schutz der Patienten vor einer Verunreinigung finde ausschließlich im präventiven Bereich statt. Die Fertigung finde in der höchsten Stufe an präventiven Maßnahmen statt, die in der Medikamentenherstellung bestehe, in der sog. aseptischen Herstellung. Dem Kläger seien im Rahmen einer Schulung am 10.12.2010 im Übrigen die internen SOP-Regeln übergeben worden. Die Kündigung sei vor diesem Hintergrund frei von Willkür erfolgt. Eine Diskriminierung wegen einer Behinderung liege nicht vor, da der Kläger keine wahrnehmbaren funktionellen Einschränkungen aufweise.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Hinsichtlich des Fortbestehensantrages ist die Klage bereits unzulässig. Der Kläger hat nicht das für einen Feststellungsantrag erforderliche besondere Feststellungsinteresse, § 256 Abs. 1 ZPO, da nicht ersichtlich ist, dass andere Beendigungstatbestände vorliegen könnten als die mit dem gesonderten Feststellungsantrag angegriffene Kündigung vom 04.01.2011.
Die weitergehende Klage ist zulässig, aber nur hinsichtlich des begehrten Zeugnisanspruches begründet. Zur Erteilung des qualifizierten Endzeugnisses mit dem Beendigungsdatum 24.01.01.2011 war die Beklagte durch Teilurteil bereits aufgrund des erteilten Anerkenntnisses, § 307 ZPO, zu verurteilen.
Hinsichtlich der weitergehenden Ansprüche ist die Klage durch Schlussurteil als unbegründet abzuweisen.
Die Beklagte hat das Arbeitsverhältnis des Klägers durch die Kündigung vom 04.01.2011 mit der während der Probezeit geltenden Kündigungsfrist von zwei Wochen zum 24.01.2011 aufgelöst.
Die Kündigung ist nicht rechtsunwirksam.
Die Kündigung kann nicht nach § 1 Abs. 1 KSchG wegen fehlender sozialer Rechtfertigung rechtsunwirksam sein, da sie vor Ablauf der in § 1 Abs. 1 KSchG geregelten Wartezeit von sechs Wochen ausgesprochen worden ist.
Die Kündigung ist nicht wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nach § 7 Abs. 1 AGG i. V. m. § 134 BGB nichtig. § 7 Abs. 1 AGG i. V. m. § 1 AGG regelt ein Benachteiligungsverbot. Gem. § 7 Abs. 1 Halbsatz 1 AGG dürfen Beschäftigte nicht wegen eines der in § 1 AGG genannten Merkmale benachteiligt werden. § 2 AGG legt den Anwendungsbereich des AGG fest. In Bezug auf den vorliegend streitgegenständlichen Fall einer Kündigung regelt § 2 Abs. 4 AGG, dass für Kündigungen ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz gelten. Sollte mit dieser Bestimmung die Anwendbarkeit des AGG auf den Ausspruch von Kündigungen ausgeschlossen sein, könnte die Bestimmung wegen Europarechtswidrigkeit unanwendbar sein. Letztlich kann dies aber dahinstehen, denn die Kammer kann nicht annehmen, dass der Kläger durch die Kündigung wegen eines der in § 1 AGG genannten Merkmale benachteiligt worden ist. Der Kläger beruft sich auf das Merkmal der Behinderung.
Nach der Gesetzesbegründung entspricht der Begriff der Behinderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes den sozialrechtlich entwickelten gesetzlichen Definitionen in § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX und § 3 BGG. Danach sind Menschen behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist (vgl. BAG 28.04.2011 - 8 AZR 515/10 demnächst EzA § 22 AGG Nr. 4). Eine Behinderung setzt danach nicht nur eine biologische oder psychische Abweichung von einem gesunden Menschen voraus. Entscheidend hinzukommen muss, dass die damit einhergehende funktionelle Einschränkung die Teilhabe am Leben beeinträchtigt (vgl. Schleusener-Suckow-Voigt AGG Kommentar zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz § 1 Rdnr. 63, 2. Aufl.).
Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht gegeben. Der Kläger selbst gibt an, dass er symptomlos HIV-infiziert ist. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, dass seine Erkrankung ein Hindernis für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder auch am Berufsleben bildet. Der im Kammertermin seitens des Klägervertreters geäußerte Gesichtspunkt, der Kläger habe fortgesetzt Medikamente einzunehmen und eine HIV-Infektion führe regelmäßig zu einer Anerkennung als Schwerbehinderter mit einem Grad von 10 %, ändert an dem Ergebnis nichts. Eine fortgesetzte Medikamenteneinnahme führt für sich genommen zu keiner funktionellen Einschränkung, die die Teilhabe am Leben beeinträchtigen kann, im Gegenteil kann sie dazu führen, das HI-Viren nicht mehr nachweisbar sein können. Ein nur 10-prozentiger Grad der Schwerbehinderung im Sinne der Regelungen im Schwerbehindertengesetz hat keine Aussagekraft bezüglich einer bestehenden Beeinträchtigung an der gesellschaftlichen Teilhabe. Dabei liegt eine Behinderung i. S. des Gesetzes nur dann vor, wenn das Diskriminierungsmerkmal schon vor der Diskriminierung vorgelegen hat. Eine Behinderung i. S. der Beeinträchtigung an der gesellschaftlichen Teilhabe liegt nicht vor, wenn die Beeinträchtigung erst durch das Verhalten des Arbeitgebers hervorgerufen wird. Denn andernfalls läge bei jeder durch das Verhalten des Arbeitgebers hervorgerufenen Beeinträchtigung eine Behinderung vor. Der Gesetzeszweck liefe in diesem Fall gänzlich ins Leere.
Die Kündigung verstößt nicht gegen das Willkürverbot nach § 242 BGB.
Der Grundsatz von Treu und Glauben in § 242 BGB bildet eine allen Rechten, Rechtslagen und Rechtsnormen immanente Inhaltsbegrenzung. Eine gegen diesen Grundsatz verstoßende Rechtsausübung ist als unzulässig anzusehen. Bei Kündigungen ist die Vorschrift des § 242 BGB neben § 1 KSchG aber nur in beschränktem Umfang anwendbar. Das Kündigungsschutzgesetz hat die Voraussetzungen und Wertungen des Grundsatzes von Treu und Glauben konkretisiert und abschließend geregelt, soweit es um den Bestandschutz und das Interesse des Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes geht. Eine Kündigung verstößt nur dann gegen § 242 BGB, wenn sie Treu und Glauben aus Gründen verletzt, die von § 1 KSchG nicht erfasst sind (vgl. BAG 25.04.2001 - 5 AZR 360/99). Der durch die zivilrechtlichen Generalklauseln der §§ 138 und 242 BGB vermittelte grundrechtliche Schutz ist umso schwächer, je stärker die mit der kleinen Betriebsklausel geschützten Grundrechtpositionen des Arbeitgebers im Einzelfall betroffen sind. Es geht vor allem darum, Arbeitnehmer vor willkürlichen oder auf sachfremden Motiven beruhenden Kündigungen zu schützen, z. B. vor Diskriminierungen i. S. v. Artikel 3 Abs. 3 GG (BVerfG 27.01.1998 - 1 Bvl 15/97 - BverfGE 97, 169), wobei der Arbeitnehmer, anders als im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes in § 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG geregelt, darzulegen und zu beweisen hat, dass die Kündigung nach § 242 BGB treuwidrig ist (BVerfG 27.01.1998 a.a.O.).
Vorliegend hat die Beklagte das Arbeitsverhältnis in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung - in der Probezeit - unstreitig wegen der HIV-Infektion gekündigt. Der Willkürvorwurf scheidet aber dann aus, wenn ein irgendwie gearteter einleuchtender Grund für die Rechtsausübung vorliegt (vgl. dazu BAG - 5 AZR 360/99 vom 25.04.2001, NZA 2002, 87, LAG Berlin vom 28.05.2002, 3 Sa 442/02).
Die in diesem Zusammenhang von der Beklagten vorgetragenen Gründe für den Ausspruch der Kündigung lassen keine sachfremden Motive erkennen. Die Beklagte hat dargetan, das sie als Medikamentenhersteller nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen (GMP-Leitfaden als Anlage 2 zur Bekanntmachung des Ministeriums für Gesundheit) Vorkehrungen zu treffen hat, die sicherstellen, dass in der Arzneimittelherstellung niemand beschäftigt wird, der an einer ansteckenden Krankheit leidet oder offene Verletzungen an unbedeckten Körperstellen aufweist Die Beklagte hat weiter dargetan, dass sie auf der Grundlage des GMP-Leitfadens in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt Dr. C. ihr internes Regelwerk zur Gesundheitsüberwachung (SOP-Regeln) einschließlich der dort vorgegebenen Formulare erstellt hatte, das vorsah, dass u. a. eine HIV-Infektion den Einsatz eines Mitarbeiters im Reinraumbereich ausschließt. Dies zeigt, dass die Beklagte bei Ausspruch der Kündigung nicht willkürlich gerade in Bezug auf den Kläger gehandelt hat, sondern keine andere Alternative zur Umsetzung des Regelwerks gesehen hat, als die, die Kündigung auszusprechen. Die Umsetzung der SOP-Regeln durch Ausspruch der Kündigung wird auch nicht dadurch willkürlich, dass die SOP-Regeln in der HIV-Infektion einen Ausschlussgrund für den Einsatz eines Mitarbeiters im Reinraumbereich sehen, obwohl die HIV-Infektion keine ansteckende Krankheit i. S. des Kapitels 2 Ziff. 2.15 des GMP-Leitfadens ist, sondern „nur“ ein Krankheitserreger in § 7 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes. Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang als nachvollziehbares Motiv für ihr Handeln angegeben, dass sie die allerletzte Sicherheit haben wollte, dass jegliches Restrisiko in Bezug auf eine Übertragung des HI-Virus ausgeschlossen wird. Es ist offensichtlich, dass ein Irrtum in diesem Bereich Menschen gefährden würde und auch für das Unternehmen existenzbedrohend bis vernichtend wäre. Deshalb ist es im Ergebnis auch unerheblich, ob Dr. C. - wie vom Kläger behauptet - in dem Gespräch am 04.01.2011 geäußert hat, dass aufgrund der Überragungswege des Virus eine Übertragung dessen „nahezu“ ausgeschlossen sei. Für andere Motive als die genannten ist der Kläger als Arbeitnehmer beweispflichtig. Für einen solchen Beweis ist der Kläger beweisfällig geblieben.
Der geltend gemachte Entschädigungsanspruch ist nicht begründet.
Die Tatbestandsvoraussetzungen für den geltend gemachten Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG sind nicht erfüllt. Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 AGG kann der Beschäftigte wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine angemessene Entschädigung verlangen. Auch der Entschädigungsanspruch setzt einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot gem. § 7 Abs. 1 i. V. m. § 1 AGG voraus.
Auch hier muss das Merkmal der Behinderung vorliegen. Wie bereits im Zusammenhang mit der Frage der Wirksamkeit der Kündigung festgestellt, liegt eine Behinderung nicht vor. Die Klage war auch hinsichtlich des Entschädigungsanspruchs abzuweisen.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 92 Abs. 1 ZPO.
Die Kosten waren der Beklagten insoweit aufzuerlegen, als sie mit dem Zeugnisanspruch unterlegen ist.
Die Entscheidung über den Wert des Streitgegenstandes ergeht gem. §§ 42 Abs. 3 GKG, 61 Abs. 1, 46 Abs. 2 ArbGG, 3 ff. ZPO.
Danach erschien es angemessen, den Streitwert für den Feststellungsantrag hinsichtlich der Kündigung nach einer Bruttomonatsvergütung zu bemessen, da der Kläger zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht ein halbes Jahr beschäftigt war. Für den Fortbestehensantrag war 1/10 des Wertes des Feststellungsantrages hinsichtlich der Kündigung anzusetzen. Der Zeugnisanspruch war mit einer Bruttomonatsvergütung von 2.200,00 EUR zu bemessen. Hinzuzurechnen waren drei Bruttomonatsvergütungen, d. h. ein Wert von 6.600,00 EUR für den Entschädigungsanspruch.